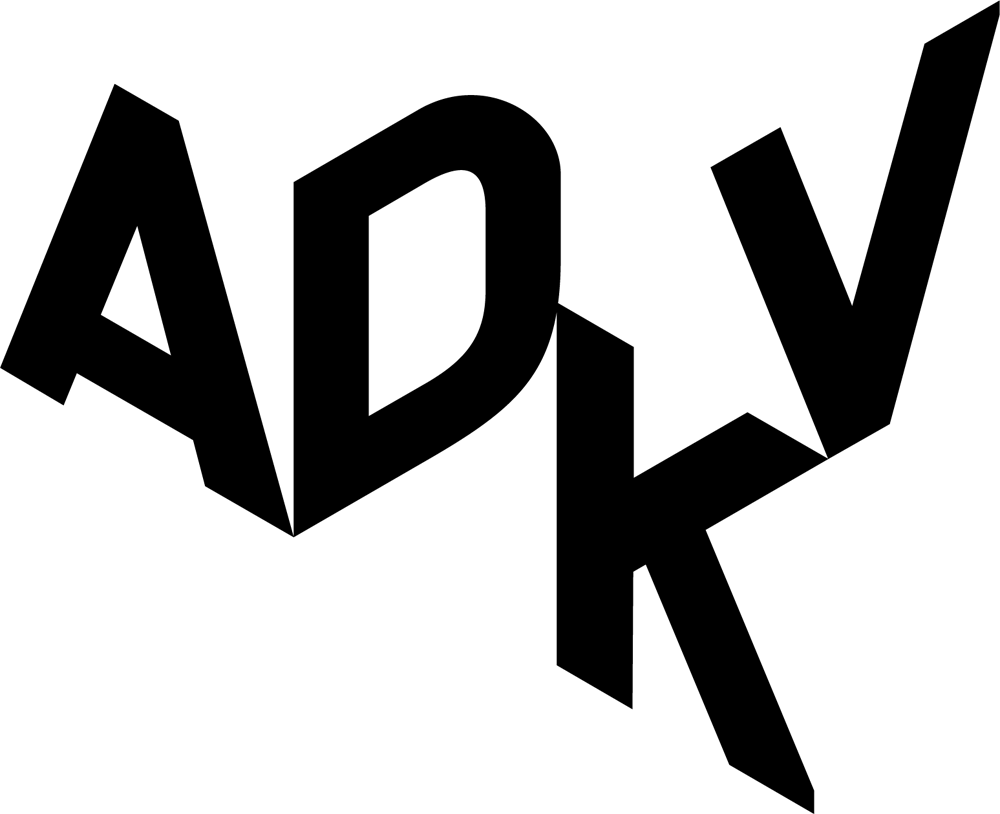Ohne Titel (14)
Peter Piller

Ein Negativ der Hände, die sich über die Dauer einer Berührung — ich bin hier— in ein anderes Material, einen Felskörper einschrieben — ich war hier. Davon ein Foto: das Abbild eines Abdruckes. Das Einfangen eines vergangenen Moments in der Zeit, in dem das Streben danach, etwas zu hinterlassen, in eine Bewegung übersetzt wurde. Ich sehe dich. Kann ein Blick, der weiß, dass er derselben Vergänglichkeit unterworfen ist, neutral sein? Unsere Maschinen werden uns überleben. Da unsere Körper ihrem Schicksal — einer Endlichkeit, die eine Unverschämtheit uns gegenüber bedeutet, die wir die Welt doch nur als etwas wahrnehmen können, das permanent durch uns hindurch läuft — unterworfen sind, werden unsere Zeit und unsere Berührungen an den empfindlichsten Stellen zuerst sichtbar: Augen, Hals, Hände — palms. Verlebt. Im Alter wie auf Reisen ist es wohl das Beste, dem Körper einfach nachzugeben, der Bewegung und Schwere, nach der er strebt. Dagegen die Gleichgültigkeit der Gegenstände allem Vergangenen gegenüber, aus dem sie bestehen.
Der Stillstand in einem Moment, der Spur geworden ist, öffnet einen schmalen Spalt zu dem unendlichen Raum, der uns vor Augen führt, was unsere Fähigkeit zu sehen eigentlich übersteigt: unsere Geworfenheit in diese gewaltige und endlose Masse an Zeit. Ich fand kein Wort für den Schwindel beim Blick in den Nachthimmel, obwohl ich mir sicher war, dass dieses spezifische Gefühl des Fallens, der eigenen Kleinheit in der Welt einen Namen haben muss. So behält diese Empfindung eine Dringlichkeit ähnlich der in den von Peter Piller gezeigten Höhlenmalereien liegenden Botschaft … Zeichen, die darauf bestehen, wortlos verstanden zu werden.
Dieser Spalt, ein schmaler Durchgang zu allen (Gleich-)Zeitigkeiten, öffnet sich zu manchen Gelegenheiten und wartet still, ob ein Blick hineinfällt. So wie in den namenlosen Schwindel, eine menschliche Spur im Gestein, im Morgengrauen: manche Stunden liegen eben näher an der Vergangenheit als andere. Die Stimmen von Gestern sind morgens näher als die des heraufziehenden Heute. In Les mains négatives von Marguerite Duras erhaschen wir einen Blick, einen Laut, eine Ahnung aus diesem Tal zwischen dem an Alter und Verfall festgemachten Zeitpunkt einer vergangenen Lebendigkeit und dem Jetzt, ein Tal, das sich mit jeder Sekunde vergrößert. Und trotz dieses unaufhaltsamen Verrinnens und Vergehens, trotz des Schreiens und Greifens nach dem Anderen, dem vergeblichen Packen und Halten zwischen Liebe und Gier, fahren wir ruhig durch den langsamen Morgen, sehen zwischen verlorenen Lichtern und Straßenschluchten die verronnene Zeit und die Schemen des beginnenden Tages, sehen die neuen Gebäude, die aus den Ruinen der Alten bestehen, so wie wir.
– Thea Mantwill